Ea commodo exercitation commodo, proident cillum,
do reprehenderit consequat et eu anim voluptate. Ut
cupidatat reprehenderit in dolor labore.
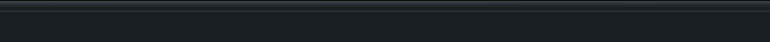


www.bergbahngeschichte.de
zur Geschichte der Großkabinenschwebe- und
Standseilbahnen in Deutschland, Österreich
und Südtirol
technische Hauptdaten der Steilstrecke (Standseilbahn)
Hersteller der Gesamtanlage: Ernst Heckel Saarbrücken / Bauart: eingleisige Standseilbahn mit Abtscher Ausweiche / Höhe Talstation Obstfelder-
schmiede: 340,8 m/ Bergstation Lichtenhain: 663,8 m / Streckenlänge: 1387,8 m / Neigung im Durchschnitt: 23,92 % / Neigung maximal: 25,00 % /
Spurweite: 1800 mm / Zugseildurchmesser: 41 mm bis 2002;
40 mm ab 2002 / Seilführungsrollen:
119 gerade / 99 schräg (2002) / Antrieb (2 Treib-
scheiben): elektrisch 220 V / Hersteller des Antriebs: 1922: Heckel Saarbrücken; 1971: Sachsenwerk Dresden; 2002: Doppelmayr Thun / Antriebs-
leistung: 1922:74 kW mit Handsteuerung; 1971: 80 kW mit halbautomatischer Steuerung; 2002: 2 x 110 kW mit elektronischer Steuerung / Fahrbe-
triebsmittel: Personenwagen, Aufsetzwagen, Güterbühne, Cabriowagen /
technische Besonderheiten:
* keine mechanische Verbindung der Antriebsstränge (elektronische Regelung der Motoren)
* Anordnung der Treibscheiben quer zur Fahrtrichtung
* unterflurige Anordnung des Antriebs
* 2 getrennte Bahnsteige in der Talstation, dadurch zweifache Abtsche Weiche
* Drehscheiben zum Beladen der Güterbühne an Tal- und Bergstation
* Überleitungsschiebebühne in der Bergstation
Aufnahmen der Anlage

Oberweißbacher Bergbahn
Historisches zur steilsten normalspurigen Standseilbahn der Welt
Im Thüringer Wald liegt eine der interessantesten Standseilbahnen des deutschsprachigen Raumes. Sie ist nicht nur die steilste breitspurige Stand-
seilbahn der Welt, sondern sie verkehrt im Pendelbetrieb mit einem Personenwagen und einer Güterbühne, welche bis zu 27 t Nutzlast aufnehmen
und damit sogar Lokomotiven befördern kann. Die Anlage besteht aus zwei Teilstrecken, der Standseilbahn Bergstrecke sowie der Adhäsionsbahn als
Flachstrecke. Die Geschichte der Bahn geht auf die Zeit um 1900 zurück, als Kleinstaaterei die thüringische Region prägte und erste Eisenbahnen auch
diesen Teil Deutschlands erschlossen. Die an den neu entstehenden Bahnlinien liegenden Ortschaften waren den entfernter liegenden Dörfern und
Städten wirtschaftlich überlegen, so dass diese nach Möglichkeiten suchten, diesem Problem zu begegnen. Die Geschichte der Oberweißbacher Berg-
bahn ist eng verbunden mit dem Namen des Regierungsbaumeisters Dr.-Ing. Wolfgang Bäseler. Dieser untersuchte verschiedene Varianten von
Adhäsions- und Zahnradbahnen um die Höhen zu erschließen, auch die Errichtung einer O-Buslinie wurde in Erwägung gezogen. All diese Projekte
scheiterten letztendlich an der großen Länge, den vielen zu errichtenden Kunstbauten und schließlich am notwendigen Geld. Wer konnte damals schon
8 Millionen Mark für die Zahnradbahn oder 10 - 23 Millionen Mark für eine Adhäsionsbahn bereitstellen? So besann man sich auf die "Metzelt" ge-
nannte Schlucht, welche von Obstfelderschmiede hinab ins Schwarzatal führt. Zunächst dachte man an den Bau einer schiefen Ebene, jedoch war hier
kein Masseausgleich möglich, außerdem konnte man die Trasse nur eingleisig bauen. So entschied man sich letztendlich für den Bau einer Standseil-
bahn nach Schweizer Vorbild, wobei die veranschlagten geringeren Baukosten von 1,3 Millionen Mark den Ausschlag gegeben haben dürften. Im
Gegensatz zu den Anlagen in der Schweiz wurde die Bahn von vornherein auf gemischten Betrieb mit einem Personenwagen und einer Güterbühne
angelegt. Um Güterwagen und Lokomotiven transportieren zu können wurde eine Güterbühne mit der enormen Tragkraft von 27 t eingesetzt und die
Anlage auf Normalspur errichtet. Es war eine große Leistung Bäselers, die Bahn in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise zu bauen. Durch die rasante
Geldentwertung waren finanzielle Zuschüsse notwendig geworden, zu "Notstandsarbeiten" an der Bahn wurden zeitweise bis zu 300 Arbeitslose ver-
pflichtet. Teilweise mussten Provisorien eingebaut werden, jedoch achtete Dr. Bäseler darauf, dass Fundamente, Fördermaschine und sicherheitstech-
nische Ausrüstungen in "friedensmäßiger Ausführung" hergestellt wurden. Die erste Fahrt auf der Reibungsstrecke fand im Jahr 1921 statt, im Spät-
sommer 1922 fanden die ersten Probefahrten auf der Bergstrecke statt und der provisorische Verkehr wurde aufgenommen. Dazu kam, dass die
Straße nach Oberweißbach durch die Straßenlokomotive, die die schweren Teile der Bergbahn zur Bergstation gebracht hatte, kaputt gefahren war. So
konnte man die Frachttarife kurzerhand um 100 % erhöhen. In die Anfangszeit der Bahn fiel auch der einzig nennenswerte Unfall. Ein Maschinist lies
den talwärts mit Überlast fahrenden Wagen ungebremst laufen, so dass die Geschwindigkeit durch die Masse des talwärtigen Seiles immer mehr zu-
nahm. Der Motor flog auseinander und Teile der Wicklung steckten im Dachstuhl. Die Beseitigung der Schäden dauerte bis zum Januar 1923, danach
erfolgte die Abnahme der Gesamtanlage durch die Aufsichtsbehörde. Regulärer Güterbetrieb wurde bis 1966 gefahren, seit dieser Zeit fährt die Bahn
mit einem Personenwagen und einem Aufsetzwagen im Regelbetrieb. Für Spezialtransporte steht die Güterbühne aber auch heute noch bereit; über
ein ansteckbares Bedienpult lässt sich die Anlage auch von dort aus steuern. Vieles lies sich noch zu Geschichte und Technik der Anlage sagen. So,
dass die Dampflok der Adhäsionsstrecke letztendlich zum Beheizen der Rohrbahnen des Pumpspeicherwerkes Hohenwarte II eingesetzt wurde sowie
die hochinteressante Seilführung in der Bergstation der Standseilbahn mit 2 quer zur Fahrtrichtung stehenden, nicht mechanisch verbundenen
Antriebsscheiben was einerseits Raum sparte, andererseits jedoch eine extrem hohe Biegebeanspruchung des Zugseils hervorruft, so dass die
Seilliegezeit anderer Anlagen von 15 - 20 Jahren nicht erreicht wird. In der Regel muss das Seil alle 4 - 8 Jahre gewechselt werde. Interessant auch
das Verfahren bei der Beladung der Güterbühne einschließlich einer kontrollierten Schlaffseillegung bei der Beladung in der Talstation und das Bewe-
gen der Güterbühne über den eigentlichen Endpunkt hinaus bei Verladearbeiten in der Bergstation einschließlich des Einsatzes einer
Überleitungsschiebebühne.
Im Sommer verkehrt die Bahn zusätzlich mit einem offenen Cabriowagen; die Anlage beherbergt eine Ausstellung zur Geschichte der Standseilbahn.












Fotos: G. Kretzschmar






Fotos: J. Gönnert

